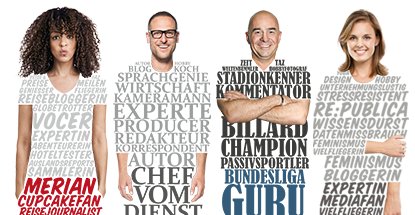„Das Gerede über die ‚Digital Natives‘ ist mir viel zu platt“
Datenjournalist Lorenz Matzat spricht im Interview mit Ben Schwan über seine Arbeit und die Frage, wie die Technik den deutschen Journalismus besser machen kann.
 Matzat hat Ende 2010 das Datenjournalismus-Kollektiv OpenDataCity mitgegründet und betreibt das Blog Datenjournalist.de. Aktuell baut er in Berlin mit Lokaler.de ein „Geo-Informations-System (GIS) für zeitgemäße Medienangebote und intelligente Öffentlichkeitsarbeit“ auf.
Matzat hat Ende 2010 das Datenjournalismus-Kollektiv OpenDataCity mitgegründet und betreibt das Blog Datenjournalist.de. Aktuell baut er in Berlin mit Lokaler.de ein „Geo-Informations-System (GIS) für zeitgemäße Medienangebote und intelligente Öffentlichkeitsarbeit“ auf.
torial: Herr Matzat, wenn man es einmal in drei Sätzen zusammenfasst – was ist Datenjournalismus überhaupt und was lässt sich damit auf redaktioneller Seite anfangen?
Lorenz Matzat: Datenjournalismus versucht Erkenntnisse aus Datensätzen zu ziehen und benutzt diese Datensätze auch für die Darstellung dieser Erkenntnisse. Dabei kommen digitale Werkzeuge zum Einsatz, Software und extra programmierte Anwendungen, um die Daten zu ordnen und zu kombinieren sowie sie zu sichten, zu analysieren – und gegebenenfalls zu visualisieren. Redaktionen können damit in einer Welt, die immer digitaler wird, adäquat recherchieren und passende Erzählformen entwickeln.
torial: Und was kann der Leser damit anfangen?
Matzat: Die Betrachter, Rezipienten oder User können neue Perspektiven auf Sachverhalte und Zusammenhänge finden und erhalten in manchen Fällen statische Visualisierungen und interaktive Anwendungen, um sich mit einem Thema auseinandersetzen zu können. Dank Datenbanken können sie dann in manchen Fällen individuell auf den jeweiligen User selbst oder spezifische Interessen zugeschnittene Informationen erhalten. Das ist etwas, was analoge Trägermedien nicht leisten können.
torial: So mancher alter Printkollege wird sich sagen – jetzt habe ich schon die Umstellung in Richtung Internet überlebt, nun muss ich auch noch programmieren lernen. Wie lassen sich solche Barrieren überwinden?
Matzat: Niemand verlangt von allen Journalisten, dass sie programmieren lernen sollen. Solche Barrieren gilt es es meiner Meinung nach nicht zu überwinden. Vielmehr ist es ratsam, dass manche Journalisten in einer Redaktion zumindest rudimentär programmieren lernen beziehungsweise es können. Es geht darum, zu wissen, was unter der Haube der Rechner, der mobilen Geräte und des Internets geschieht; wie aus Daten Erkenntnisse geschält werden können. Und wie Informationen datenbankgestützt, „data driven“ berichtet werden können und welche Expertise möglicherweise extern eingekauft werden muss.
In den Trainings, die ich in diversen Redaktionen gemacht habe, habe ich durchaus auch ehemalige ältere „Printkollegen“ getroffen, die jetzt fit und fähig den Bereich Online bespielen und keine Berührungsängste vor basalen Formen des Programmierens haben. Eher erstaunlich ist, dass nicht wenige jüngere Journalisten, denen ich begegnet bin, recht ignorant den Details des Digitalen gegenüber sind. In dem Zusammenhang kann ich nur sagen: Das Gerede über die „Digital Natives“ ist mir viel zu platt.
torial: Wie groß ist die Datenjournalismus-Szene in Deutschland mittlerweile?
Matzat: Es gibt einige Redaktionen, die Datenjournalismus regelmäßig betreiben: Zeit Online, Süddeutsche Online, Spiegel Online, die taz ab und zu, manche Zeitschriften und auch manche Öffentlich-Rechtliche sowie die Deutsche Welle. Erwähnenswert sind auch Regionalblätter wie die Ruhrnachrichten, die ihren Mitteln entsprechend datenjournalistisch arbeiten. Im deutschsprachigen Raum wäre noch die NZZ zu nennen; auch in Österreich finden sich Arbeiten in dem Genre.
Journalistinnen und Journalisten, die explizit davon reden würden, dass sie hauptsächlich oder viel Datenjournalismus betreiben, gibt es wohl maximal zwei Dutzend im deutschsprachigen Raum; es dürfte aber einige hundert Journalisten geben, die datenjournalistische Methoden und Tools immer wieder einsetzen.
torial: Was entgegnen Sie Vorwürfen, Datenjournalismus sei nur ein Hype?
Matzat: Erst einmal empfinde ich es nicht als Vorwurf, wenn etwas als Hype bezeichnet wird. Es ist normal, dass ein Thema Konjunktur bekommt. Und ein Hype kann eben auch zu recht bestehen.
Die Aufmerksamkeit für Datenjournalismus rührt daher, dass er eine Tür aufgestoßen hat und dem Internet-Zeitalter gemäße Methoden und Erzählformen entwickelte. Endlich war klar, dass man etwas anderes machen kann, als nur analoge Trägermedien im Browser abzubilden und abgedroschene Multimediaformate einzusetzen. Mittlerweile würde ich behaupten, dass der Hype vorbei ist. Nimmt man das Datablog des Guardian etwa als Maßstab – es wurde Anfang 2009 gestartet – ist data-driven journalism nunmehr fünf Jahre alt. Und ist eben Mainstream geworden, weil das einst neue Genre seine Nützlichkeit wiederholt unter Beweis gestellt hat.
torial: Das Internet hat auch dazu geführt, dass es eine Art Echokammer gibt – viel wird voneinander abgeschrieben und originäre Recherchen scheinen manchem Verlag zunehmend zu teuer. Ist Datenjournalismus hier eine Lösung?
Matzat: Nein. Eine einfache Lösung ist es nicht. Datenjournalismus ist teuer, wie eben auch gute Recherche teuer ist, nicht zuletzt weil sie zeitaufwendig ist. Wenn Sie sich gleich ein ganzes Team leisten wollen – und guter Datenjournalismus ist eigentlich fast immer Teamarbeit – braucht es dazu noch hochspezialisiertes Personal.
Neben Programmierern, Statistikern und Designern benötigen Sie dann ja auch noch jemanden, der diese Personen anleitet, koordiniert und auch noch mit dem Rest einer Redaktion und einem Verlag sprechen kann. Und versuchen Sie mal fähige Programmierer und Designer mit Hang zum Journalismus auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Und welche Redaktion, außer den großen, kann dann noch in Konkurrenz mit den Summen treten, die Start-ups mit einem Investment oder Softwarefirmen zahlen können?
torial: Wie offen reagieren Verlage, wenn Sie zu Ihnen gehen und sagen, Sie hätten da eine Idee für eine spannende Anwendung? Oder kommen die längst von sich aus auf Sie zu – und Kollektive wie OpenDataCity, zu dem Sie lange gehörten?
Matzat: Sowohl als auch. Letztlich geht es zu, wie wenn ich eine Artikelidee pitche. Als hilfreich hat sich herausgestellt, mindestens schon eine Skizze der geplanten Anwendung, ein „Mock-up“ oder sogar einen Prototypen zu haben. Wenn jemand etwas klicken kann, versteht er oder sie viel schneller die Idee und das Potenzial eines Themas.
Wichtig ist selbstverständlich auch, die entsprechenden Ansprechpartner in den Redaktionen zu haben, die solche Konzepte verstehen und bewerten können. Andersherum kommen Redaktionen mit Themen oder Datensätzen. Vermehrt passiert das übrigens auch seitens NGOs, Stiftungen oder gar Unternehmen, die für die Öffentlichkeitsarbeit mehr mit ihren Daten darstellen wollen. Eigentlich jede Institution sitzt auf Datenbergen.
torial: Es stellen sich sicher auch ganz praktische Fragen. Wenn ein freier Datenjournalist einem Online-Medium eine Anwendung anbietet, wie rechnet der das dann ab?
Matzat: Also letztlich liefern Sie im Fall einer interaktiven Anwendung Programmcode ab. Es sollte sich im Vorhinein über die Funktionen und Inhalte der Software verständigt, faktisch ein „Pflichenheft“ verfasst werden und nach Abgabe entsprechend eine Rechnung gestellt werden.
torial: Was passiert im Datenjournalismus als nächstes? Eine Verbesserung der vorhandenen Werkzeuge, die hier und da noch rudimentär wirken?
Matzat: Wie gesagt, Datenjournalismus als Methode und Genre ist meiner Meinung nach normal und anerkannt. Ja, die Werkzeuge werden besser – sie sind es im Vergleich zu vor fünf Jahren schon deutlich und die Bandbreite nimmt stetig zu.
Doch wirklich neue Formate kann es meiner Meinung im Datenjournalismus nur noch selten geben. Allerdings sind die Weiten des Internets journalistisch kaum kartiert. Betrachtet man sich etwa die Arbeit über den Empfehlungsmechanismus des Videodienstes Netflix, wird deutlich: das Entschlüsseln, Beobachten, Beschreiben und Bewerten von Algorithmen, die sich mehr und mehr in unserem immer digitaleren Alltag breit machen, ist ein hochspannendes und anspruchsvolles Feld für Datenjournalisten.