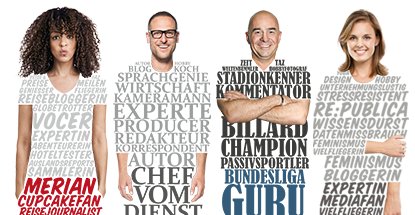„Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir Onliner uns kumulieren“
„Süddeutsche.de“-Chef Stefan Plöchinger spricht im torial-Interview über seinen Aufstieg in die Chefredaktion der „Süddeutschen“ – und die Frage, ob Paid Content im deutschen Internet wirklich funktionieren kann.
torial: Herr Plöchinger, wie fühlt man sich als (relativ) frisch gebackenes Mitglied der Chefredaktion der „Süddeutschen“?

Alexander Svensson / Flickr / cc-by-2.0
Stefan Plöchinger: Sehr gut – und ehrlicherweise nicht so viel anders als vorher. Die Zusammenarbeit in der Chefredaktion der SZ war ja schon in den vergangenen Jahren intensiv und fruchtbar. Die Personalie ist ein Signal und ein Vollzug des Faktischen.
torial: Als es Medienmeldungen gab, dass Sie als „Digitaler“ womöglich nicht in die Chefredaktion gewählt werden könnten, gab es die mittlerweile legendäre „Hoodiejournalismus“-Kampagne vieler Online-Kollegen auf Twitter. Glauben Sie, dass die Ihnen geholfen hat?
Plöchinger: Ach, ich kann es kaum noch hören. Nachdem ein komischer Text in der „FAS“ zu meiner Personalie erschienen ist, war die Kapuzengeschichte erst mal eine lustige Solidaritätsaktion. Aber nach ein, zwei Tagen hab auch ich mir gedacht: Das ist ein Hype, und ich bin kein großer Freund von Hypes, zumal wenn sie die falsche Botschaft verbreiten. In der SZ – die nicht umsonst als grundliberale, bunte Redaktion gilt – ist es durchaus üblich, mit Hoodies herumzulaufen, und keineswegs nur bei Onlinern.
Warum berauschen wir uns plötzlich an einem 08/15-Kleidungsstück, als wäre es eine journalistische Scheidelinie? Auf einer Meta-Ebene bleibt bei mir ein komisches Gefühl. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir Onliner uns auf welche Art auch immer kumulieren, um unsere besondere Eigenständigkeit gegenüber anderen Kollegen zu vertreten – unsere Aufgabe muss es wie für alle anderen sein, Grabenkämpfe zu vermeiden und Gemeinsamkeiten zu fördern.
torial: Eigentlich wirkt es unglaublich, dass auch 20 Jahre nach dem Beginn der Kommerzialisierung des Web in Deutschland offenbar noch solche Mauern zwischen Onlinern und Printmenschen bestehen. Dabei nutzen doch alle das Netz und schätzen es etwa für Recherchen. Haben wir es hier mit Standesdünkel zu tun?
Plöchinger: Wie schon öfter gesagt, die Erfahrung hier im Haus ist gänzlich anders. Nach dreieinhalb Jahren in diesem Job, nach intensiver Arbeit an einer Geschäftsmodell- und einer permanenten Strukturreform zwischen Print und Online kann ich nur sagen: Die SZ besteht aus sehr vielen schlauen Leuten, die verstanden haben, dass wir zum einen eine sehr gute Tageszeitung machen müssen – die entgegen aller Branchendepressionen bei uns immer noch funktioniert und gutes Geld bringt – sowie zum anderen sehr gute digitale Angebote. Nur so wird unsere Art, Journalismus zu machen, die digitale Disruption überleben.
torial: Journalismus sollte ja Journalismus sein, egal in welchem Medium.
Plöchinger: Exakt. Es kommt nicht darauf an, auf welcher Plattform wir Leser mit dem Journalismus der SZ versorgen – wichtig ist, dass wir auf allen Plattformen den bestmöglichen Journalismus machen, auf der Höhe der Möglichkeiten. Da sind wir noch nicht immer, wo wir sein wollen, aber wir sind schon weit gekommen, und das Schöne ist: Die digitalen Möglichkeiten erweitern sich fortlaufend.
Wir werden also auch in zwei, drei Jahren noch nicht dort sein, wo wir dann sein wollen. Diese permanente Herausforderung an unsere Organisation und Arbeitsweise empfinde ich als spannend. Wobei ich weiß: Unser Verständnis von Journalismus, lieber nachzudenken als schnell zu schießen, lieber in die Tiefe als auf den Boulevard zu gehen, wird uns dabei die wichtigste Hilfe sein. Das ist es, was Leute nach wie vor suchen, von uns erwarten und von uns bekommen, ob gedruckt oder digital.
torial: Onlinejournalisten haben viel mehr Daten als ihre Printkollegen. Sie sehen, welche Themen gehen und welche nicht. Wie stark beeinflusst das das Blattmachen? Und umgekehrt, sorgt es dafür, schwer Verdauliches wegzulassen?
Plöchinger: Um in Ihrem Bild zu bleiben: Was schwer verdaulich ist, muss keineswegs schlecht geschmeckt haben. Ein Irrglaube ist zum Beispiel, dass lange Texte, abstrakte Essays oder Sozialthemen im Netz nicht funktionieren. Quatsch, unsere Zahlen beweisen das Gegenteil. Artikel dürfen gern lang, aber nicht langweilig sein, sie dürfen abstrakt, aber nicht unverständlich sein, und unsere Leser interessieren sich für gesellschaftliche Streitfragen mehr als für vieles andere.
Ich denke, bei „Focus Online“ würden Sie andere Auskünfte bekommen, aber so ist das zum Glück im Netz 2014: Viele verschiedene Marken prägen das publizistische Geschäft, und einige haben so wenig miteinander zu tun, dass sie zwar von Branchendiensten in ihrer Reichweite verglichen werden, aber das ist schon das Ende der Gemeinsamkeiten. Wir freuen uns, wenn wir in die Daten schauen, über den Geschmack anspruchsvoller Leser, und wollen unsere Seite vor allem für sie weiterentwickeln, nicht für die maximale Masse.
torial: Sie haben auf „Süddeutsche.de“ neue Formate wie 360 Grad eingeführt, bei denen Themen in der Tiefe beleuchtet werden. Wundert es Sie, dass es so etwas nicht öfter gibt?
Plöchinger: Im Gegenteil freut es mich, wenn Leser solche Formate nur bei uns bekommen. Wir sollten ja nicht alle das gleiche machen im Netz, sondern das, was unsere Leser von uns erwarten. In diesem Fall: Tiefe, Hintergrund, Verständnis. Wobei ich auch bei anderen Qualitätsseiten neue Formate sehe, die ich spannend finde.
torial: „Süddeutsche.de“ war vor Ihrer Zeit für die fiesen Bilderstrecken bekannt. Ist 360 Grad eine Art Wiedergutmachung?
Plöchinger: Ach, Bilderstrecken. Ich würde sie keineswegs verdammen – nehmen Sie Buzzfeed, das mit unserem Journalismus insgesamt sicher wenig zu tun hat, da finden Sie auch lustige, gut gemachte Fotostorys. Gleiches gilt bei uns zum Beispiel für die Einzelkritiken nach Fußballspielen, die wir immer als Galerie machen, weil das dadurch angenehmer portioniert und illustriert wird. Bildstrecken an sich sind nicht schuld daran, dass sie missbraucht werden.
Man kann über sie manche Geschichten besser erzählen. Gerade debattieren wir intern wieder, weil wir drei Fotostrecken als Seitenaufmacher hatten, für die man das eher nicht sagen konnte. Was zählt, sind Reflexion und eine gute Mischung. 360 Grad gehört schon jetzt, nach zwei Folgen, zu unserer DNA, aber daneben kann man gut andere, spielerische Formate haben.
torial: Wie weit sind Pläne gediehen, Ihre Website kostenpflichtig zu machen? Wird es im Winter losgehen?
Plöchinger: Darauf richten wir uns ein. Das wird ziemlich anspruchsvoll, kein Zweifel. Aber ich bin mir sicher, dass wir nur mit Anzeigenfinanzierung im Netz nicht sehr viel weiter kommen, als wir schon gekommen sind. Journalismus, wie wir ihn sehen, wie er sich in Projekten wie 360 Grad und „Die Recherche“ ausdrückt oder einfach in unserer Arbeit an einer möglichst akkuraten, vertrauenswürdigen, ethischen Nachrichtenseite – dieser Journalismus kostet mehr als Durchschnittsware.
Ich vertraue darauf, dass wir bei einem gewissen Kreis anspruchsvoller Leser Verständnis dafür bekommen. Wichtig wäre, dass nach uns auch andere Verlage kapieren, wie wichtig eine breite Finanzierung für gute Publizistik ist. Wenn viele mitmachen, wird mehr Lesern bewusster werden als heute, wie wichtig respektive gefährdet das ist, was wir für die Gesellschaft zu leisten versuchen.
torial: Beim „Metered“-Modell, das Sie ja offenbar teilweise planen, hat man als smarter Leser manchmal das Gefühl, etwas veralbert zu werden, da sich solche Paywalls leicht überspringen lassen. Funktionieren sie trotzdem?
Plöchinger: Man sieht das an der „New York Times“ und vielen anderen Webseiten. Der Ansatz bringt einen zumindest an einen gewissen neuen Punkt in der Entwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Wie man es danach noch elaborieren kann, dazu sehen wir ja jetzt schon neue Ansätze, zum Beispiel wieder bei der New York Times.
torial: Sehen Sie eine Zukunft, in der eine Online-Publikation genauso wirtschaftlich erfolgreich sein kann, wie es Printtitel einst waren?
Plöchinger: Journalismus macht über den Daumen gepeilt 40 Prozent der Kosten in einem klassischen Zeitungsverlag aus; Druck und Vertrieb sind der größte Posten – entfallen aber bei digitaler Produktion. Schon wenn man sich diesen Aspekt klarmacht, ist offensichtlich, dass wir es in beiden Welten mit ganz anderen Kalkulationen und Perspektiven zu tun haben.
Nimmt man hinzu, dass ein Projekt wie „Krautreporter“ aus dem Stand heraus eine Abo-artige Finanzierung für ein ganzes Jahr schaffen kann – ausschließlich gründend auf ein gewisses Vertrauen der Leser in ein Zukunftsversprechen -, dann habe ich Zuversicht, dass digitaler Journalismus sich auf Dauer tragen kann. Alles andere wäre außerdem eh nur Verharren im Pessimismus, statt die Herausforderung kreativ anzunehmen.