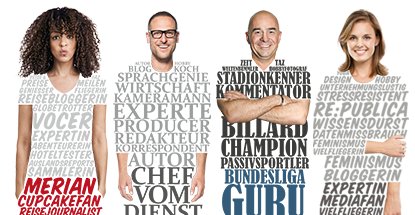Was vom Journalismus bleibt, wenn das Tablet geht
Das Tablet als solches ist gerade mal fünf Jahre am Markt – und fast schon wieder erledigt. So ist das nun mal in der digitalen Welt, die Trends kommen und gehen hier schneller als überall sonst. Drei Trends werden sich aber auf längere Sicht halten. Eine Prognose.
Weiß eigentlich irgendjemand noch, für was so ein iPad gut sein soll? Das ist eine Frage, die man vor fünf Jahren, als das erste Tablet auf den Markt kam, kaum zu stellen gewagt hätte. Weil die Logik dieses Geräts nahezu zwingend auf der Hand lag: Der Bildschirm regiert künftig die mediale Welt – und der Bildschirm des Smartphones ist zu klein, um darauf vernünftig lesen oder andere Dinge konsumieren zu können. Deshalb also die klare Abgrenzung: Das Smartphone für die schnellen Dinge zwischendurch, das Tablet für die wirklichen Inhalte.
Fünf Jahre später weiß man eines nahezu sicher: Zu einem wirklich mobilen Gerät sind Tablets nie geworden, zumindest nicht im Alltag der ganz normalen Nutzer. Weder in der 7- noch in der 10-Zoll-Variante: Das Tablet ist kein Stammgast in den Taschen und Rucksäcken derer, die gerade irgendwohin unterwegs sind. Zumal neben einer gewissen Sperrigkeit noch ein anderer Grund hinzu kommt: Neben dem allgegenwärtigen Smartphone müsste man noch ein zweites Gerät mit sich herumtragen, wenn man Inhalte mobil nutzen will. Was ziemlich umständlich und unangenehm ist und den Trumpf des kompakten und beweglichen Geräts fast schon wieder zunichte macht.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
So gesehen ist es kein wirkliches Wunder, dass der Trend bei den Smartphones immer mehr zu den Phablets geht und selbst Dauerverweigerer Apple inzwischen ein solches Gerät im Portfolio hat. Wer ein solches Gerät mit sich trägt, braucht zumindest für unterwegs kein Tablet mehr. Und ob man ausschließlich für zuhause ein besseres, weil größeres Lesegerät wie ein Tablet braucht – diese Frage haben anscheinend viele Nutzer für sich schon beantwortet: Die Umsätze der Tablets sind von den einstmals prophezeiten, konstanten Steigerungen ein gutes Stück entfernt.
Es ist also nicht sonderlich gewagt, wenn man aus dieser Entwicklung bei den Gerätegattungen für den Journalismus einen ganz einfachen Schluss zieht: Mobiler Journalismus muss in den kommenden Jahren insbesondere auf Smartphones funktionieren. Sie sind das Instrument, auf denen in den kommenden Jahren alles zusammen laufen wird. Das ist nicht einfach nur eine Entwicklung für Endgeräte, für die man sich interessieren kann oder eben auch nicht. Der Trend zum Smartphone hat auch noch eine andere Besonderheit: Man muss endgültig über neue Formen des Journalismus nachdenken. Weil das Smartphone im Gegensatz zum Tablet eben nicht einfach nur ein Lesegerät in groß und multimedial ist. Und weil es nicht nur mobil, sondern dann eben doch auch zuhause genutzt wird. Man könnte auch sagen: immer und überall und das auch noch mit wachsender Begeisterung.
15 Jahre später: Das erste konvergente Ding
Die Älteren werden sich womöglich noch erinnern: Vor gut 15 Jahren wurde in der Branche der Begriff „Konvergenz“ bis zum Erbrechen gebraucht. Von allen und jedem für alles und jedes. Wer irgendwas mit Konvergenz in die Runde warf, konnte sich kopfnickender Zustimmung sicher sein. Auch und vor allem deswegen, weil niemand so richtig wusste, was konvergente Medien überhaupt sein sollten. Was wiederum damit zusammenhing, dass es weder Geräte noch Inhalte gab, die so etwas wie Konvergenz überhaupt ermöglichten. Die Welt war ja dann doch noch ziemlich analog zu dieser Zeit.
Mit einer unwesentlichen Verspätung von 15 Jahren ist die Geschichte mit der Konvergenz doch noch wahr geworden. Von Konvergenz redet man jetzt nicht mehr ganz so häufig, dafür umso lieber von Smartphones. Aber egal, wie man es nennt – am Ende kommt das gleiche raus: ein Endgerät, das alles kann und im Gegensatz zu den Konvergenz-Pionieren von 2000 auch noch mobil ist. Man darf die Debatte darum, was genau mit dieser Konvergenz jetzt wohl gemeint ist, mit guten Gewissen wieder rauskramen. Weil sie in leicht abgewandelter Form die alles entscheidende Frage der nächsten Jahre ist: Wie funktioniert Journalismus für Smartphones beliebiger Größe, der mehr ist, als einfach nur die Abbildung normaler Webseiten auf kleineren Displays?
Natürlich, diese Debatte beginnt jetzt gerade erst wieder neu. Weswegen es darauf auch noch keine Antworten gibt, wie es solche fertigen Antworten momentan nirgends gibt im digitalen Journalismus. Ein paar Dinge lassen sich aber jetzt schon festhalten. Und es wäre gut wenn man sich darauf einstellen würde. Bevor es uns mal wieder andere vormachen, denen wir dann in der kommende Dekade mehr oder weniger wieder hinterherhecheln.
Mini-Bewegtbild: Live, in Echtzeit, schnell, roh. Und 16:9.
 Vermutlich gibt es keine Darstellungsform im Journalismus, die sich so gewandelt hat wie das Bewegtbild. Sowohl, was Inhalte als auch Häufigkeit und Funktionalität angeht: Der Wandel vom aufwändig produzierten Inhalt, den nur ein paar wenige privilegierte Sender hinbekommen, hin zum allgegenwärtigen Schnipsel, den inzwischen de facto jeder herstellen kann, ist atemberaubend. Bewegtbilder beherrschen schon jetzt unseren Alltag und es ist kaum zu erwarten, dass sich daran etwas ändern wird.
Vermutlich gibt es keine Darstellungsform im Journalismus, die sich so gewandelt hat wie das Bewegtbild. Sowohl, was Inhalte als auch Häufigkeit und Funktionalität angeht: Der Wandel vom aufwändig produzierten Inhalt, den nur ein paar wenige privilegierte Sender hinbekommen, hin zum allgegenwärtigen Schnipsel, den inzwischen de facto jeder herstellen kann, ist atemberaubend. Bewegtbilder beherrschen schon jetzt unseren Alltag und es ist kaum zu erwarten, dass sich daran etwas ändern wird.
Im Gegenteil: Videos gehören heute als fester Bestandteil zu nahezu allen Angeboten im Netz. Selbst ein ehemaliger 140-Zeichen-Dienst wie Twitter rollt demnächst seine Videofunktion in der App aus. Nach der Initialzündung durch Vine haben auch andere schnell erkannt, welch ungeheures Potential in verschlanktem Bewegtbild steckt. Das Prinzip ist überall das gleiche, sei es bei Twitter, Instagram oder Vine: Videos lassen sich in kürzester Zeit in erstaunlicher Qualität drehen und hochladen. Die Beschränkung auf mehr oder minder kurze Längen hat dem ganzen nicht geschadet. Im Gegenteil.
Dabei entstanden und entstehen allerdings auch neue Trends. Weil es beispielsweise schon alleine wegen der verknappten Längen wenig Sinn macht, den klassischen gebauten Beitrag für das Netz zu machen, bekommt Bewegtbild eine andere Funktion. Immer öfter wird es als Echtheit-Tool verwendet. Manchmal, mit Tools wie Bambuser beispielsweise, auch als Live-Material. Das bedeutet auch, dass Post-Production und andere Nachbearbeitungen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Devise: kurz und authentisch anstatt lang und aufgebrezelt.
Dass Twitter übrigens bei den Videos nur Hochformat zulässt, ist ein kleiner Schönheitsfehler. Aber nur ein kleiner. Ansonsten gilt für Bewegbild 2015 mehr denn je die Regel: quer ist schöner.
Geschrumpfte Artikel – und trotzdem eine Geschichte
Natürlich kann man auch auf dem Smartphone einen Artikel lesen. Man kann sogar lange Artikel lesen. Es ist also Unsinn, wenn man mobilen Journalismus auf irgendwas mit kleinen Häppchen reduzieren will. Das hat man schon zu den Urzeiten des Netzes versucht. Ich erinnere mich gut, als ich 1997 für eine Tageszeitung eine erste Onlinetruppe versucht habe aufzubauen. Die Redaktion eines Mediendienstes hat dies portraitiert und geschrieben, meine hauptsächliche Aufgabe bestünde darin, bestehende Inhalte einzudampfen. Das war damals schon hoffnungsloser Quatsch. Und es wird um keinen Deut intelligenter, wenn man den Unfug heute wiederholt. In dieser übertragenen Version des Jahres 2015 lautet der Quatsch von 1997 ungefähr so: Auf dem Smartphone müssen die Dinge in erster Linie kleiner und kürzer werden. Niemand bestreitet, dass das ein potentieller Aspekt sein kann. Reduziert man jedoch die Entwicklung eines mobilen Smartphone-Journalismus auf den Aspekt der Länge, wird man damit ähnliche Bruchlandungen erleben, wie all jene Redaktionen, die 1998 ff gedacht hatten, es reiche aus, aus 150 Zeilen in der Zeitung 15 Zeilen fürs Netz zu machen. Die Konsequenz einer solchen Denkweise wäre ja lediglich, dass der selbe Artikel auf dem Smartphone nur noch 1,5 Zeilen haben darf.
Apropos Zeilen: Zeilen und Zeichen sind eine Größenordnung vergangener Tage. So wie es der gute alte Artikel auch ist. Digitaler und mobiler Journalismus bedeutet auch, dass Geschichten erzählt werden, ohne Geschichten zu erzählen. Zumindest nicht mehr ausschließlich in der klassischen Form, 80 Zeilen, klassischer Artikelaufbau. Bevor jetzt wieder der erwartete Dogmatiker-Aufschrei kommt: Natürlich kann und wird man auch weiterhin gute Texte veröffentlichen und man wird sie auch lesen und auf einem Tablet womöglich genau so gerne wie auf gedrucktem Papier. Aber bisher hat noch jedes neue Endgerät neue Erzählformen hervorgebracht. Da macht auch das Smartphone keinen Unterschied.
Wer sich Kanäle wie Twitter oder Instagram genauer anschaut, der stellt fest: Sie können, geschickt genutzt, sehr viel mehr sein als die Verlautbarungsmaschinen, für die viele von ihnen irrtümlich gehalten werden. Man kann Videos dort inzwischen gezielt als Storytelling-Tool einsetzen (siehe auch die Überlegungen zum Thema Video). Dass Twitter inzwischen auch eine Video-Funktion in seine App einbaut, hat durchaus seine Gründe. Vine mit seine 6-Sekündern, Instagram mit den 15-Sekündern – sie alle sorgen dafür, dass wir inzwischen Videos als festen Bestandteil der täglichen journalistischen Tätigkeiten nutzen können.
Was alles wiederum nicht bedeutet, dass man Journalismus jetzt generell auf diese Kanäle auslagern muss. Aber wenn doch sehr offensichtlich ist, wohin die Trends gehen, dann wäre es ja auch mal eine Überlegung wert, diese Trends und Inhalte auch in die eigenen Angebote zu integrieren. Bietet sich ja auch irgendwie an, gerade jetzt, wo man womöglich die eigenen mobile Präsenzen ein wenig überdenken sollte.
Here, there and everywhere: Apps, Webseiten, Soziale Netzwerke
Die größte Errungenschaft des Smartphones ist zumindest für Journalisten auch sein größter Fluch: Es kann alles sein. Alles auf einmal. Man kommt also zumindest an einer Überlegung erst einmal nicht vorbei: Wenn man Journalismus für ein Gerät macht, das alles kann – dann muss man wohl seine Angebote so gestalten, dass sie ebenfalls alles können. Na gut, nicht alles. Aber vieles.
In erster Linie heißt das auch: Natürlich kann und soll man weiter Journalismus im Kontext der eigenen Marke anbieten. Man wird sich aber gerade bei Smartphones noch stärker als ohnehin schon an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die eigenen Geschichte auch auf Plattformen existieren, die eben nicht die eigenen sind. Der Trend zur Auflösung gewohnter Strukturen wird durch das endgültig konvergente Wundergerät Phablet endgültig aufgelöst. Eine Information, die irgendwann auf dem Smartphone landet, kann also alles sein: Text, Video, Artikel, Posting in einem sozialen Netzwerk. Was bedeutet, dass dieses Stück zwar in dem Kontext der eigenen Webseite stattfinden kann, aber keineswegs muss. Das macht die Sache etwas kompliziert.
Das ändert nichts daran, dass sich der große Trend der Marken – nämlich die Fragmentierung – auch im Kleinen immer weiter fortsetzt. Journalistischer Erfolg wird sich in den nächsten Jahren auch über die Antwort auf die Frage definieren, wie man dieses Fragmentieren hinbekommt, ohne dabei selbst in der Unkenntlichkeit zu verschwinden…