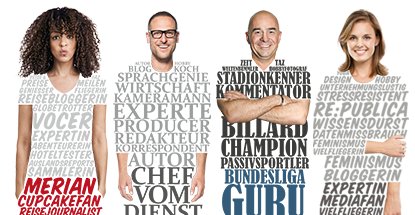Journalismus&Netz im November: Für welchen Journalismus zahlt das Publikum?
Im November ging es sehr viel um die Finanzierung von (Innovationen im) Journalismus. Vor allem die staatliche Presseförderung erntet viel Kritik. Dazu die Frage: Für welchen Journalismus zahlt das (junge) Publikum? Und auch die Diskussion, wie man über Attentäter berichten soll, kochte wieder hoch.
New York Times bei 7 Millionen Digital-Abonnenten
10 Millionen Abonnenten will die New York Times bis 2025 haben. Fast 7 Millionen sind es schon heute, wie die NYT im November bekanntgab. Und mehr als 6 Millionen haben ein Digitalabo, auf den Vertriebszweig Print entfallen „nur noch“ 800.000 Abonnenten. Die Strategie, nur noch einen Artikel frei anzubieten und danach zum Abschluss eines (Probe-)Abos aufzurufen, das 17 Dollar pro Monat kostet, scheint aufzugehen. Das weitere Wachstum soll auch aus dem Ausland kommen. Schon jetzt kommen 18 Prozent des Umsatzes aus dem Ausland, wie der Deutschlandfunk in einer Analyse der NYT-Geschäftszahlen schreibt.
Übersicht über Finanzierungsmodelle für Medien
Von solchen Zahlen können deutsche Verlage nur träumen. Klar, der Vergleich hinkt, die USA sind viel größer als Deutschland, die New York Times ist eine Weltmarke und es verstehen viel mehr Menschen auf der Welt Englisch als Deutsch. In Deutschland gibt es mit Spiegel, Zeit, Süddeutscher Zeitung, FAZ und vielleicht noch dem Handesblatt nur eine Handvoll Titel, die auch für ausländische Leser interessant sein könnten, meint Kai-Hinrich Renner in der Berliner Zeitung. In seinem lesenswerten Artikel diskutiert er alle gängigen Modelle der Finanzierung von Medienangeboten: Crowdfunding, Einzelverkauf von Artikeln, Stiftungsgelder und schließlich die staatliche Förderung.
Viel Kritik am Modus der staatlichen Presseförderung
Da hat sich im November Bahnbrechendes ereignet: Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte gibt es staatliche Subventionen für die Presse: 220 Millionen Euro stellt das Bundeswirtschaftsministerium für „Innovationsförderung“ zur Verfügung. Die Verlage sollen so die digitale Transformation ihrer Unternehmen vorantreiben.
Doch es gibt jede Menge Kritik an dem Deal: Die Subventionen sollen nach der Auflagenhöhe ausgezahlt werden, das bevorzugt größere Medienunternehmen. Wer hat, dem wird gegeben. Weil auch Onlineshops und Rubrikenportale, über die Immobilien und Autos verkauft werden, gefördert werden, stellt sich die Frage, ob Wirtschaftsminister Altmaier wirklich dem Journalismus helfen will.
Auch Günter Herkel kann dem staatlichen Hilfspaket im Verdi-Magazin Menschen Machen Medien wenig abgewinnen. Er sieht darin eine „staatlich unterstützte Pressekonzentration“. Innovation im deutschen Journalismus sei bislang überwiegend woanders entstanden, in speziellen Labs von SWR, ZDF und MDR, am Medieninnovationszentrum Babelsberg oder am MediaLab Bayern.
Innovation sponsored by Google
Zu den größten finanziellen Förderern von Innovationen im deutschen Journalismus zählt ja interessanterweise Google, obwohl der US-Internetkonzern seit Jahren mit der deutschen Verlagslandschaft über das Leistungsschutzrecht streitet (wir berichteten). Auch Medienforscher Christopher Buschow hält die Tatsache, dass es bei der Innovationsförderung Google braucht, im lesenswerten Interview mit netzpolitik.org für einen „bezeichnenden und tragischen Befund“.
Buschow hat übrigens kürzlich mit Christian-Mathias Wellbrock ein Gutachten zur Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland verfasst, in dem er u.a. die Barrieren für Innovation benennt und Empfehlungen für eine Innovationspolitik im deutschen Journalismus gibt.
Arbeitskreis Digitale Publisher kritisiert Wettbewerbsverzerrung
Protest ruft die geplante Presseförderung bei digitalen Publishern hervor, die nach Lage der Dinge keine Zuschüsse aus dem Topf erhalten würden. 31 von ihnen haben sich im Arbeitskreis digitale Publisher zusammengeschlossen und eine Erklärung abgegeben, in der sie sich gegen diese „massive Wettbewerbsverzerrung“ wenden und eine Gleichbehandlung „sämtlicher Verbreitungskanäle – ob Text, Ton oder Bild“ fordern.
Krautreporter gewinnen neue Mitglieder
Zu den Unterzeichnern gehören auch die Krautreporter, die ein gutes Beispiel für den Ansatz sind, ein digitaljournalistisches Angebot ausschließlich über Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Das ist keine leichte Aufgabe, gerade in Corona-Zeiten. Nach mehrjährigem kontinuierlichem Wachstum waren die Mitgliederzahlen von Krautreporter seit Ende 2019 rückläufig. Die Redaktion startete daraufhin eine Werbekampagne, in der sie ihr Geschäftsmodell offenlegte und auch eigene Fehler eingestand. Der Aufruf zeigte die gewünschte Wirkung, Krautreporter konnte neue Mitglieder hinzugewinnen und die angestrebte 15.000er-Marke erreichen.
Das ist aller Ehren Wert, man muss aber auch dazu sagen, dass es immer wieder hartnäckigster Abo-Aufrufe (um nicht zu sagen Bettel-Mails) bedarf, um die Mitgliederzahl zu steigern bzw. konstant zu halten. Die Krautreporter machen auch noch immer Verlust, wie sie in ihrem Blogbeitrag auch schreiben. So sympathisch ich Krautreporter auch finde: Es ist noch immer ein Nischenangebot.
Will das Publikum inspirierenden Journalismus?
Die Krautreporter und noch stärker Perspective Daily zählen zu den Angeboten, die einordnenden und konstruktiven Journalismus machen. Auch wenn er sie namentlich nicht erwähnt, dürfte SZ-Innovationsexperte Dirk von Gehlen in seinem Blogbeitrag „Inspirierender Journalismus“ an sie gedacht haben. Darunter versteht er einen Journalismus, der „Denkwert“ liefert und seinen Leser:innen das Gefühl gibt, „nachher mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Dinge (und vielleicht auch Lösungen) zu sehen.“ Mit einem Journalismus, der das schafft, lassen sich auch langfristig digitale Bezahlmodelle begründen, meint von Gehlen.
Sowohl Krautreporter als auch Perspective Daily zählen zu den Redaktionen, die großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Ihren Mitgliedern legen. Etwa, indem sie nach gewünschten Themen Fragen oder das Wissen ihrer Community bei der Recherche anzapfen.
Auch Journalismus-Forscherin Alexandra Borchardt konstatiert im journalist, dass sich junge Leute „mehr Nutzwert für ihr Leben, bessere Erklärungen und gerne auch ein bisschen Spaß wünschen“. Ihr Beitrag „Das Ende des journalistischen Bauchgefühls“ ist ein Plädoyer dafür, dass Journalisten mehr und genauer auf das hören sollten, was sich das Publikum wünscht und was es braucht. Ihr Fazit: „Journalismus ist manchmal Kunst, aber viel öfter Dienstleistung. Seine Grundhaltung ist Mut. Vor allem sollte es aber auch Demut sein.“
Ins gleiche Horn stößt Vice-Chefredakteur Felix Dachsel in seinem Blogpost über die Frage, was der deutsche Journalismus von jungen Medien lernen kann: „Journalisten müssen schreiben, um ihr Publikum zu erreichen, sonst kann man es auch bleiben lassen.“
Google zeigt Infokästen des Gesundheitsministeriums
Auch im November war Google wieder in den Medien-Schlagzeilen, allerdings weniger wegen seiner Innovationsförderung, sondern wegen eines Deals mit dem Bundesgesundheitsministerium. Wer nach Krankheiten wie „Coronavirus, Influenza, Grippe oder Allergie“ sucht, bekommt auf Google Infokästen mit Informationen vom und Links zum Gesundheitsministerium angezeigt. Insgesamt gibt es 160 solcher „Knowledge Panels“. Den Zeitschriftenverlegern gefällt das gar nicht, sie sehen in dem Angebot eine „Verdrängung der privaten Presse durch ein staatliches Medienangebot auf einer digitalen Megaplattform“ und damit einen „einmaligen und neuartigen Angriff auf die Pressefreiheit“. Auch Presseverlage beschweren sich. „Nur empören sich vor allem die besonders laut, die vorher stumm Googles Geld genommen hatten“, schreibt dazu die taz mit Blick auf das Google-Geld aus der Digital News Initiative.
Ethische Verfehlungen bei Berichten über Terroranschlag in Wien
Am 2. November kam es in Wien zu einem Terroranschlag, bei dem ein vermutlich islamistisch gesinnter Mann vier Passanten erschoss, ehe er von der Polizei getötet wurde. Breaking News-Lagen sind immer auch eine Herausforderung für Medien. Daran gescheitert sind einige Boulevardmedien, vor allem Oe24 und die Kronen Zeitung in Österreich, die Video- und Bildmaterial veröffentlichten, auf dem zu sehen ist, wie ein Opfer erschossen wird. Beim österreichischen Presserat gingen mehr als 1500 Beschwerden ein, so viele wie nie zuvor, wie Der Standard berichtet.
In Deutschland hat die Bild falsche Gerüchte verbreitet, etwa, dass es eine Geiselnahme in einem Schnellrestaurant gegeben habe. Das Bildblog hat noch mehrere Bild-Fehler zusammengetragen.
In unmittelbarer Nähe zu den Tatorten in der Wiener Innenstadt war zum Tatzeitpunkt auch Florian Klenk, Chefredakteur des Wochenmagazins „Falter“. Er twitterte viel zu den Ereignissen, warnte, verbreitete auch einen Fehlalarm der Polizei und zählte zu den ersten Journalisten, die den Namen des getöteten Attentäters nannten. Dafür hat er jede Menge Kritik einstecken müssen. In einem lesenswerten Interview mit Übermedien nimmt Falter zu der Kritik Stellung, besonders interessant finde ich die Passagen, in denen es darum geht, ob und wenn ja in welchem Maß Journalisten über solche Attentäter und über die Opfer berichten sollen.