Weckruf durchs Leistungsschutzrecht
Das Leistungsschutzrecht (LSR) ist da, doch die Verlage wissen offenbar noch nicht so recht, was sie genau damit anfangen sollen. Die emotionale Debatte um das Gesetz hat aber viele Verlage aus dem digitalen Dornröschenschlaf aufgeweckt und sie motiviert, sich Gedanken um eigene digitale Geschäftsmodelle zu machen.
Der 1. März war ein guter Tag für die Verleger. CDU/CSU und FDP machten ihnen ein vorgezogenes Ostergeschenk: Sie verabschiedeten im Bundestag das Leistungsschutzrecht, das die Verleger so lange gefordert hatten. Umso überraschender, dass es vonseiten der Verlage kein Siegesgeschrei, sondern eine überraschend verhaltene Reaktion gab. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) gaben eine gemeinsame Erklärung ab: Im LSR sehen sie „ein faires Instrument, über die gewerbliche Nutzung ihrer Inhalte durch Suchmaschinen und Aggregatoren selbst zu entscheiden“, heißt es da ganz nüchtern.
Auch Christoph Keese, Konzerngeschäftsführer „Public Affairs“ der Axel Springer AG und als solcher Inkarnation des verlegerischen Drängens auf ein Leistungsschutzrecht, hielt sich bislang auffällig zurück. Er twitterte: „Das beschlossene #LSR bildet einen guten Rechtsrahmen für Journalismus im Netz. Es ist besser und wirkungsvoller, als Kritiker vermuten.“ Über den Rechtsrahmen und wie er ausgelegt wird, wird aber schon gestritten.
Auf Betreiben von Google sind „kleinste Textausschnitte“ nicht vom LSR betroffen. Keese und die Regierungsfraktionen im Bundestag sind im Gegensatz zu Google der Ansicht, dass auch die Google-Snippets unter das neue Gesetz fallen. Der auf Internet-Recht spezialisierte Anwalt Thomas Stadler glaubt „nicht, dass die vom Bundestag verabschiedete Fassung des Leistungsschutzrechts die normale Suchmaschinenfunktionalität erfasst“, schreibt er in seinem Blog.
Einige Verlage verzichten schon aufs LSR
Viele Verlage kommen nach wie vor nicht mit einer Meinung um die Ecke, ob sie das Leistungsschutzrecht für sich nutzen wollen, wie Robert Basic feststellen musste. Mir ging es mit einer Anfrage bei der SWHM-Pressestelle genauso: Überhaupt keine Reaktion – auch auf mehrmaliges Nachhaken nicht. Klar ist: Nicht alle Verlage befürworten das Leistungsschutzrecht. Viele haben sogar ausdrücklich erklärt (#lsrfrei), dass sie darauf verzichten und die kostenfreie Nutzung von Snippets ihrer Seiten gestattet ist. Die Seite http://mediainfo.de/index/lsr-frei dokumentiert, welche Verlage das getan haben. Das Problem dabei ist, dass es keinen HTML-Tag gibt, mit dem ein solcher Verzicht maschinell ausgedrückt werden kann.
Investitionen in Suchmaschinenoptimierung
In der Praxis ist es oft so, dass gerade große Websites wie welt.de, SPIEGEL ONLINE und Sueddeutsche.de viel Energie in die Suchmaschinenoptimierung investieren, um dort gut gefunden zu werden. sz.de-Chefredakteur Stefan Plöchinger sagt: „Google ist unser Kiosk, der viele neue Leser bringt.“ In seinem privaten Blog hat Plöchinger mal erklärt, dass bis zu 40 Prozent der Leser via Google ihren Weg auf sz.de gefunden haben.
Redaktionen betreiben im großen Stil Suchmaschinenoptimierung, während ihre Geschäftsführer und Verlage ein Leistungsschutzrecht einfordern – paradoxer geht es kaum.
Meines Erachtens sind deutsche Journalisten mehrheitlich gegen das Leistungsschutzrecht, viele arrivierte Verleger sind verhalten dafür, sprechen das aber nicht deutlich aus, sondern lassen die Verbände und Springer die Kampagne dafür führen.
Lieber eigene Bezahlmodelle schaffen
Die Leistungsschutzrecht-Debatte hatte aber auch ihr Gutes: Viele Journalisten haben sich ernsthaft mit dem Thema befasst, das Gesetz hinterfragt. Viele scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass die Nachteile (vor allem der Reichweitenverlust) überwiegen und das Gesetz viel zu schwammig formuliert ist (jetzt, da keine verbindliche Textlänge aufgenommen wurde, erst recht). Es ist – auch jetzt – vollkommen unklar, wie viel Geld man mit Leistungsschutzrecht-Lizenzen verdienen könnte. Die Verlage haben keinen direkten Einfluss auf die Gesetzgestaltung, alle müssen mit dem gleichen Gesetz leben – und all den offenen Fragen, die es noch aufwirft.
In dieser nun schon fast vier Jahre währenden Diskussion sind manche Verleger aber aufgewacht und scheinen sich klar geworden zu sein, dass sie nur im eigenen Reich unbeschränkte Gestaltungshoheit haben. Daher haben sich einige Verlage Gedanken gemacht, wie denn ein originäres digitales Geschäftsmodell aussehen könnte. Die Paid-Content-Debatte ist revitalisiert. Hier setzt aber jeder auf sein eigenes Modell: Metered Payment wie bei der Welt, freiwillige Abos à la taz, Freemium wie bei vielen Regionalzeitungen, pro Artikel zahlen wie beim Nordbayerischen Kurier. Die SZ hat für ihre Website einen noch nicht näher definierten Leserclub angekündigt, der kostenpflichtig sein und sich von all den genannten Modellen unterscheiden soll. Jedes dieser Häuser hat eine andere Klientel, andere Inhalte, insofern ist es logisch, dass auch die Geschäftsmodelle unterschiedlich ausfallen.
Das ist das gute Recht der Verlage: Sauber recherchierte Texte und aufwendig produzierte Specials kosten Geld. Im Prinzip sehen das auch die Nutzer ein. Wenn es den Verlagen gelingt, mit ihrem spezifischen Ansatz und einem einfachen Bezahlvorgang schwarze Zahlen zu schreiben, wird sich bald keiner mehr um das jetzt noch so emotional aufgeladene Leistungsschutzrecht scheren.

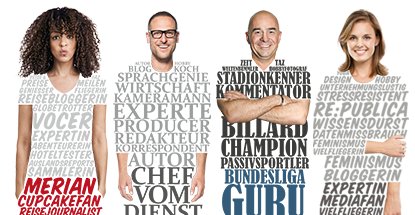

Sehr gut! Ich glaube auch – der Markt muss die Fakten schaffen! Nur machen sie es sich aus meiner Sicht unnötig schwer, wenn ich an jedem Kiosk eine neue Währung raus kramen soll…ein medienübergreifendes, selbstbestimmtes, Abo-freies Bezahl-Tool wäre glaube ich für alle gut!
ein einheitliches Bezahl-Tool wäre natürlich praktisch, ich fürchte, das wird an den unterschiedlichen Interessen der Verlage scheitern, die außerdem ja alle selbst die Daten ihrer Käufer haben wollen